Bremstechnologie für die Zukunft
Kreativität für das Bremsen
12. Februar 2025 agvs-upsa.ch – Durch Reibung wird ein Bremsmoment am Rad erzeugt und damit das Fahrzeug verzögert. Was seit Jahren bewährte Physik darstellt, erfährt aufgrund der kommenden Euro-7-Emissionsgrenzwerte, die auch den Bremsenabrieb limitieren, neue Denkfelder. Ingeniöse Innovationen sorgen für Kreativität in der Umsetzung. Andreas Senger

Um den Bremsabrieb einer Scheibenbremse in der Entwicklung zu prüfen, wird der Bremsstaub auf einem geschlossenen Prüfstand abgesogen und analysiert. Foto: AVL
Eine Bremsscheibe oder eine Bremstrommel arbeiten nach demselben physikalischen Prinzip: Durch Reibung zwischen Bremsbelag und Metall wird kinetische Energie in Wärmeenergie umgewandelt. Das am Rad entstehende Bremsdrehmoment wird durch den wirksamen Reifenradius in eine Bremskraft zwischen Reifen und Fahrbahn umgewandelt, die entgegen der Fahrtrichtung wirkt. Durch die elektronische Bremskraftverteilung ist heutzutage spurstabiles Bremsen an der Tagesordnung.
Dieser Bremsvorgang wurde mit dem E-Antrieb revolutioniert. Eine E-Maschine kann nicht nur für Vortrieb, sondern durch Rekuperation auch für Verzögerung sorgen. Durch Umwandeln von kinetischer Energie in elektrische Energie entsteht am Rad ebenfalls ein Bremsdrehmoment mit Umwandlung über den wirksamen Reifenradius in eine Bremskraft. Die maximale Verzögerung ist allerdings limitiert, soll die durch Induktion umgewandelte Bewegungsenergie in elektrische Energie auch von der Batterie aufgenommen werden können.

Beim vorgestellten Prototyp der In-Drive-Bremse dreht der Bremsbelag (Hand links) und die kühlflüssigkeitsgekühlte Bremsscheibe (links mit Aussenverzahnung) steht still. Die 360°-Bremsscheibe ist via Innenverzahnung mit dem Antriebswellenflansch verbunden. Die Betätigung wird von Mercedes noch nicht gezeigt. Foto: Mercedes-Benz
Obwohl im potenten E-Antrieb kurzzeitig über 1000 Ampère durch die Leitungen fliessen, verhindert die Hochvoltbatterie längere Rekuperationsphasen. Durch den Innenwiderstand werden die Zellen beim Aufnehmen des Stromes (Innenwiderstand der Zellen) stark erwärmt. Abhilfe würde einzig Hochleistungswiderstände bringen (wie bei historischen Bergbahnen), die den Rekuperationsstrom in Wärme umwandeln.
Für länger andauernde Bremsvorgänge wie bei Passabfahrten oder bei höheren Verzögerungen (über der Rekuperationsbremsung) muss auch künftig eine Reibbremsanlage verbaut werden. Mercedes-Benz argumentiert, dass bei Rekuperationen aktuell rund 0,3 MW Bremsleistung möglich, für eine Notbremsung aber 2,2 MW nötig sind. Durch die künftige Euro-7-Emissionsvorgabe werden Reifen- und Bremsstaubemissionen limitiert. Entsprechend werden neue Denkansätze verfolgt, um die gesetzlich vorgeschriebene Mindestabbremsung zu gewährleisten und andererseits die Bremspartikel in Anzahl und Masse zu reduzieren.
Die Materialpaarung optimieren
Der Bremsbelag hat grossen Einfluss auf das Bremsverhalten, die Lebensdauer und die Bremsstaubemissionen. Verschiedene Bestandteile (Siehe AUTOINSIDE 12/24 Seite 34 bis 37) sorgen für einen hohen Reibwert zwischen Belag (feststehend) und Bremsscheibe oder -trommel (drehend). Dass die technischen Herausforderungen der Wärmeabfuhr, das Fadingverhalten (nachlassender Reibwert bei hohen Temperaturen) und gleichzeitig eine möglichst hohe Lebensdauer heute in der Forschung und Entwicklung durch entsprechende Inhaltsstoffe gelöst werden können, ist die eine Seite der Medaille. Neu müssen auch die Bremsstaubemissionen deutlich reduziert werden. Verschiedene Konzepte, nebst einer optimalen Materialwahl, sorgen für innovative Weiterentwicklungen.

Die neue Bremsanlage ist direkt links und rechts an der E-Maschine angeflanscht. Foto: Mercedes-Benz
Trommelbremse für Preisbewusste
Wenn der Bremsstaub innerhalb des Bremssystems verweilt, dann werden auch keine Emissionen in die Umwelt transferiert. Die Trommelbremse ist seit jeher Garant, dies grossmehrheitlich umzusetzen. Für Fahrzeuge im Klein- und Mittelklassesegment wird dies eine valable Möglichkeit darstellen, die gesetzliche Mindestabbremsung zu gewährleisten und gleichzeitig die Euro-7-Emissionsgrenzwerte einzuhalten. Allerdings sind Trommelbremsen aufgrund der geringeren Wärmeabgabe nur bedingt auch an der Vorderachse einsetzbar. Ist das Fahrzeug schwer, kommt die Trommelbremse durch das Fading an seine Grenzen. Durch die schlechte Wärmeabfuhr werden die Bremsbeläge so stark erhitzt, dass der Reibwert sinkt und die Bremswirkung nachlässt.
Ein weiterer Nachteil ist die relativ hohe, ungefederte Masse von aktuellen Trommel- und Scheibenbremsen. Je schwerer ein Fahrzeug, desto grösser muss die Bremsleistung sein und entsprechend grösser müssen die Bremskomponenten dimensioniert werden. Bei teuren Fahrzeugen kommen entsprechende Karbon-Keramik-Bremsscheiben zum Einsatz. Für günstigere Fahrzeuge sind diese exorbitant teuren Verzögerer ökonomisch nicht umsetzbar. Bei beiden konventionellen Scheiben und Trommeln werden innovative Leichtbauvarianten umgesetzt, bei denen einzig der Reibring aus Gusseisen oder Edelstahl besteht. Der Bremsscheibenträger oder die Trommel werden aus einer Leichtmetalllegierung oder Stahl hergestellt. Diese Verbundscheiben und -trommeln sind leichter. Das Thema Bremsstaub kann durch einen Oberflächenauftrag mittels Laserschweissverfahren und den entsprechenden Reibbelägen verbessert werden. Diese Optionen gibt es grössenteils auf dem Markt und sie werden künftig weiterentwickelt und optimiert.

Die zwei Kühlflüssigkeitsanschlüsse sorgen bei der Bremsscheibe für Wärmeabfuhr. Foto: Mercedes-Benz
Radbremse komplett neu gedacht
Um die ungefederte Masse gering zu halten, gab es in der Vergangenheit die innenliegenden Bremsscheiben. Hersteller wie Alfa Romeo, Audi, DKW, Citroën, NSU oder Jaguar verringerten zwar die ungefederte Masse, sorgten mit der Übertragung des Bremsdrehmoments über die Antriebswelle aufs Rad aber für einen höheren Verschleiss der Gelenke. Trotzdem hat Mercedes-Benz in einer Neuinterpretation diese Idee aufgenommen und deutlich modifiziert. Die Ende 2024 vorgestellte In-Drive-Bremse nimmt die Idee der Massenreduktion am Rad auf. Die Reibbremse wird links und rechts direkt an die E-Maschine und damit an den Differenzialausgleich angebaut. Eine äusserst innovative Idee ist die Kühlung, welche bei den historischen Pendants oft zu Problemen führte. Bei der In-Drive-Bremse dreht nicht die Bremsscheibe und wird durch den feststehenden Bremsbelag gebremst, sondern der Bremsbelag rotiert und die Bremsscheibe steht. Entsprechend ist es möglich, die Reibungswärme der Bremsscheibe über die Kühlflüssigkeit (je zwei Anschlüsse nach aussen) abzuführen und das Bremsfading zu vermeiden. Der Bremsbelag wird nicht als Kreissegment, sondern als komplette Scheibe hergestellt und mittels Verzahnung mit dem Antriebsflansch verbunden. Dieser Antriebsflansch ist auf der einen Seite mit dem Differenzial verbunden und auf der anderen Seite das Tripodegelenk der Antriebswelle eingesteckt.
Durch eine noch nicht gezeigte Betätigung des Prototyps wird nun von Innen ein feststehender Reibring seitlich an den rotierenden Bremsbelag geschoben, welcher sich seinerseits ebenfalls seitlich an die aussenstehende Bremsscheibe bewegen kann. Damit entsteht die Reibung, welche die kinetische Energie in Wärme umwandelt. Um die innere Reibscheibe zu kühlen, wird die Wärme entweder mit Öl oder Kühlflüssigkeit abgeführt und die Betätigung wird konsequenterweise mittels Hydraulikbetätigung erfolgen.

Die Zulieferindustrie tüftelt an Absaugvorrichtungen oder passiven Filtersystemen, um den Bremsstaub der Bremsscheibenvarianten während dem Verzögerungsvorgang abzusaugen (aktiv) oder aufzunehmen (passiv). Foto: Tallano
Für Mercedes-Benz ergibt sich durch die Verlegung der Radbremse zur E-Maschine hin nicht nur der Vorteil der Reduktion der ungefederten Masse von rund 40 %, sondern auch ein Aerodynamikvorteil. Weil die Scheibe nicht mehr wie bei konventionellen Konstruktionen mittels Luftzufuhr gekühlt werden muss und damit die Luftzufuhr unter dem Fahrzeug zur Radbremse wie durch die Räder zu erfolgen hat, können geschlossene Radscheiben verwendet werden. Durch das luftwiderstandsoptimierte Design der Räder wird der Energieverbrauch aufgrund der fehlenden Luftverwirbelungen verkleinert.
Im Weiteren strebt der Automobilbauer mit der In-Drive-Bremse eine Lifetime-Anwendung und damit eine Standzeit der Anlage von über 300000 Kilometern an. Durch den kreisbogenförmigen Reibbelag erscheint dies realistisch, wird die Bremse doch nur bei höheren Verzögerungsanforderungen betätigt. Im Regelfall wird durch Rekuperation gebremst. Und das Thema Bremsstaub hat der Hersteller ebenfalls clever gelöst: Durch das geschlossene Gehäuse kann kein Staub emittiert werden und mittels Auffangbehälter im unteren Gehäuseteil aufgefangen und dieser anlässlich der Wartungsarbeiten geleert werden.

Durch Laser aufgetragene Metallvarianten sorgen für eine Optimierung der Reibpartner. Foto: Laserline
Alternative Staubreduktionslösung
Wenn ein Bremshersteller seine Reibpartner materialtechnisch nicht so weit optimieren kann, um die Emissionsgrenzwerte von Euro 7 einzuhalten, können auch passive oder aktive Bremsstaubfilter zum Einsatz gelangen. Bei den passiven Systemen wird ein Filtermantel rund um die Bremsscheibe montiert und anlässlich der Wartung ausgetauscht. Bei den aktiven Systemen wird bei jedem Bremsvorgang mittels Absaugvorrichtung der entstandene Bremsstaub in ein Filterbehältnis gesaugt. Beide Konzepte sind zwar technisch umsetzbar, aber kostenmässig sowohl für die Automobilhersteller wie auch für die Kundschaft weniger interessant, da hohe Wartungskosten entstehen. Die Forschung und Entwicklung zur Reduktion des Bremsstaubes über innovative Reibpaarungen erscheint zielführender. Der Gesetzgeber zwingt die Automobilhersteller zu Innovationen im Bremsbereich und damit zur Reduktion von Partikelemissionen aus dem Strassenverkehr. Die Technik bietet Lösungen an und treibt Entwicklung und Forschung im Bremsbereich voran.

Die Wärmeabfuhr von Scheibenbremsen gegenüber Trommelbremsen ist optimaler. Foto: Bugatti

Um den Bremsabrieb einer Scheibenbremse in der Entwicklung zu prüfen, wird der Bremsstaub auf einem geschlossenen Prüfstand abgesogen und analysiert. Foto: AVL
Eine Bremsscheibe oder eine Bremstrommel arbeiten nach demselben physikalischen Prinzip: Durch Reibung zwischen Bremsbelag und Metall wird kinetische Energie in Wärmeenergie umgewandelt. Das am Rad entstehende Bremsdrehmoment wird durch den wirksamen Reifenradius in eine Bremskraft zwischen Reifen und Fahrbahn umgewandelt, die entgegen der Fahrtrichtung wirkt. Durch die elektronische Bremskraftverteilung ist heutzutage spurstabiles Bremsen an der Tagesordnung.
Dieser Bremsvorgang wurde mit dem E-Antrieb revolutioniert. Eine E-Maschine kann nicht nur für Vortrieb, sondern durch Rekuperation auch für Verzögerung sorgen. Durch Umwandeln von kinetischer Energie in elektrische Energie entsteht am Rad ebenfalls ein Bremsdrehmoment mit Umwandlung über den wirksamen Reifenradius in eine Bremskraft. Die maximale Verzögerung ist allerdings limitiert, soll die durch Induktion umgewandelte Bewegungsenergie in elektrische Energie auch von der Batterie aufgenommen werden können.

Beim vorgestellten Prototyp der In-Drive-Bremse dreht der Bremsbelag (Hand links) und die kühlflüssigkeitsgekühlte Bremsscheibe (links mit Aussenverzahnung) steht still. Die 360°-Bremsscheibe ist via Innenverzahnung mit dem Antriebswellenflansch verbunden. Die Betätigung wird von Mercedes noch nicht gezeigt. Foto: Mercedes-Benz
Obwohl im potenten E-Antrieb kurzzeitig über 1000 Ampère durch die Leitungen fliessen, verhindert die Hochvoltbatterie längere Rekuperationsphasen. Durch den Innenwiderstand werden die Zellen beim Aufnehmen des Stromes (Innenwiderstand der Zellen) stark erwärmt. Abhilfe würde einzig Hochleistungswiderstände bringen (wie bei historischen Bergbahnen), die den Rekuperationsstrom in Wärme umwandeln.
Für länger andauernde Bremsvorgänge wie bei Passabfahrten oder bei höheren Verzögerungen (über der Rekuperationsbremsung) muss auch künftig eine Reibbremsanlage verbaut werden. Mercedes-Benz argumentiert, dass bei Rekuperationen aktuell rund 0,3 MW Bremsleistung möglich, für eine Notbremsung aber 2,2 MW nötig sind. Durch die künftige Euro-7-Emissionsvorgabe werden Reifen- und Bremsstaubemissionen limitiert. Entsprechend werden neue Denkansätze verfolgt, um die gesetzlich vorgeschriebene Mindestabbremsung zu gewährleisten und andererseits die Bremspartikel in Anzahl und Masse zu reduzieren.
Die Materialpaarung optimieren
Der Bremsbelag hat grossen Einfluss auf das Bremsverhalten, die Lebensdauer und die Bremsstaubemissionen. Verschiedene Bestandteile (Siehe AUTOINSIDE 12/24 Seite 34 bis 37) sorgen für einen hohen Reibwert zwischen Belag (feststehend) und Bremsscheibe oder -trommel (drehend). Dass die technischen Herausforderungen der Wärmeabfuhr, das Fadingverhalten (nachlassender Reibwert bei hohen Temperaturen) und gleichzeitig eine möglichst hohe Lebensdauer heute in der Forschung und Entwicklung durch entsprechende Inhaltsstoffe gelöst werden können, ist die eine Seite der Medaille. Neu müssen auch die Bremsstaubemissionen deutlich reduziert werden. Verschiedene Konzepte, nebst einer optimalen Materialwahl, sorgen für innovative Weiterentwicklungen.

Die neue Bremsanlage ist direkt links und rechts an der E-Maschine angeflanscht. Foto: Mercedes-Benz
Trommelbremse für Preisbewusste
Wenn der Bremsstaub innerhalb des Bremssystems verweilt, dann werden auch keine Emissionen in die Umwelt transferiert. Die Trommelbremse ist seit jeher Garant, dies grossmehrheitlich umzusetzen. Für Fahrzeuge im Klein- und Mittelklassesegment wird dies eine valable Möglichkeit darstellen, die gesetzliche Mindestabbremsung zu gewährleisten und gleichzeitig die Euro-7-Emissionsgrenzwerte einzuhalten. Allerdings sind Trommelbremsen aufgrund der geringeren Wärmeabgabe nur bedingt auch an der Vorderachse einsetzbar. Ist das Fahrzeug schwer, kommt die Trommelbremse durch das Fading an seine Grenzen. Durch die schlechte Wärmeabfuhr werden die Bremsbeläge so stark erhitzt, dass der Reibwert sinkt und die Bremswirkung nachlässt.
Ein weiterer Nachteil ist die relativ hohe, ungefederte Masse von aktuellen Trommel- und Scheibenbremsen. Je schwerer ein Fahrzeug, desto grösser muss die Bremsleistung sein und entsprechend grösser müssen die Bremskomponenten dimensioniert werden. Bei teuren Fahrzeugen kommen entsprechende Karbon-Keramik-Bremsscheiben zum Einsatz. Für günstigere Fahrzeuge sind diese exorbitant teuren Verzögerer ökonomisch nicht umsetzbar. Bei beiden konventionellen Scheiben und Trommeln werden innovative Leichtbauvarianten umgesetzt, bei denen einzig der Reibring aus Gusseisen oder Edelstahl besteht. Der Bremsscheibenträger oder die Trommel werden aus einer Leichtmetalllegierung oder Stahl hergestellt. Diese Verbundscheiben und -trommeln sind leichter. Das Thema Bremsstaub kann durch einen Oberflächenauftrag mittels Laserschweissverfahren und den entsprechenden Reibbelägen verbessert werden. Diese Optionen gibt es grössenteils auf dem Markt und sie werden künftig weiterentwickelt und optimiert.

Die zwei Kühlflüssigkeitsanschlüsse sorgen bei der Bremsscheibe für Wärmeabfuhr. Foto: Mercedes-Benz
Radbremse komplett neu gedacht
Um die ungefederte Masse gering zu halten, gab es in der Vergangenheit die innenliegenden Bremsscheiben. Hersteller wie Alfa Romeo, Audi, DKW, Citroën, NSU oder Jaguar verringerten zwar die ungefederte Masse, sorgten mit der Übertragung des Bremsdrehmoments über die Antriebswelle aufs Rad aber für einen höheren Verschleiss der Gelenke. Trotzdem hat Mercedes-Benz in einer Neuinterpretation diese Idee aufgenommen und deutlich modifiziert. Die Ende 2024 vorgestellte In-Drive-Bremse nimmt die Idee der Massenreduktion am Rad auf. Die Reibbremse wird links und rechts direkt an die E-Maschine und damit an den Differenzialausgleich angebaut. Eine äusserst innovative Idee ist die Kühlung, welche bei den historischen Pendants oft zu Problemen führte. Bei der In-Drive-Bremse dreht nicht die Bremsscheibe und wird durch den feststehenden Bremsbelag gebremst, sondern der Bremsbelag rotiert und die Bremsscheibe steht. Entsprechend ist es möglich, die Reibungswärme der Bremsscheibe über die Kühlflüssigkeit (je zwei Anschlüsse nach aussen) abzuführen und das Bremsfading zu vermeiden. Der Bremsbelag wird nicht als Kreissegment, sondern als komplette Scheibe hergestellt und mittels Verzahnung mit dem Antriebsflansch verbunden. Dieser Antriebsflansch ist auf der einen Seite mit dem Differenzial verbunden und auf der anderen Seite das Tripodegelenk der Antriebswelle eingesteckt.
Durch eine noch nicht gezeigte Betätigung des Prototyps wird nun von Innen ein feststehender Reibring seitlich an den rotierenden Bremsbelag geschoben, welcher sich seinerseits ebenfalls seitlich an die aussenstehende Bremsscheibe bewegen kann. Damit entsteht die Reibung, welche die kinetische Energie in Wärme umwandelt. Um die innere Reibscheibe zu kühlen, wird die Wärme entweder mit Öl oder Kühlflüssigkeit abgeführt und die Betätigung wird konsequenterweise mittels Hydraulikbetätigung erfolgen.

Die Zulieferindustrie tüftelt an Absaugvorrichtungen oder passiven Filtersystemen, um den Bremsstaub der Bremsscheibenvarianten während dem Verzögerungsvorgang abzusaugen (aktiv) oder aufzunehmen (passiv). Foto: Tallano
Für Mercedes-Benz ergibt sich durch die Verlegung der Radbremse zur E-Maschine hin nicht nur der Vorteil der Reduktion der ungefederten Masse von rund 40 %, sondern auch ein Aerodynamikvorteil. Weil die Scheibe nicht mehr wie bei konventionellen Konstruktionen mittels Luftzufuhr gekühlt werden muss und damit die Luftzufuhr unter dem Fahrzeug zur Radbremse wie durch die Räder zu erfolgen hat, können geschlossene Radscheiben verwendet werden. Durch das luftwiderstandsoptimierte Design der Räder wird der Energieverbrauch aufgrund der fehlenden Luftverwirbelungen verkleinert.
Im Weiteren strebt der Automobilbauer mit der In-Drive-Bremse eine Lifetime-Anwendung und damit eine Standzeit der Anlage von über 300000 Kilometern an. Durch den kreisbogenförmigen Reibbelag erscheint dies realistisch, wird die Bremse doch nur bei höheren Verzögerungsanforderungen betätigt. Im Regelfall wird durch Rekuperation gebremst. Und das Thema Bremsstaub hat der Hersteller ebenfalls clever gelöst: Durch das geschlossene Gehäuse kann kein Staub emittiert werden und mittels Auffangbehälter im unteren Gehäuseteil aufgefangen und dieser anlässlich der Wartungsarbeiten geleert werden.

Durch Laser aufgetragene Metallvarianten sorgen für eine Optimierung der Reibpartner. Foto: Laserline
Alternative Staubreduktionslösung
Wenn ein Bremshersteller seine Reibpartner materialtechnisch nicht so weit optimieren kann, um die Emissionsgrenzwerte von Euro 7 einzuhalten, können auch passive oder aktive Bremsstaubfilter zum Einsatz gelangen. Bei den passiven Systemen wird ein Filtermantel rund um die Bremsscheibe montiert und anlässlich der Wartung ausgetauscht. Bei den aktiven Systemen wird bei jedem Bremsvorgang mittels Absaugvorrichtung der entstandene Bremsstaub in ein Filterbehältnis gesaugt. Beide Konzepte sind zwar technisch umsetzbar, aber kostenmässig sowohl für die Automobilhersteller wie auch für die Kundschaft weniger interessant, da hohe Wartungskosten entstehen. Die Forschung und Entwicklung zur Reduktion des Bremsstaubes über innovative Reibpaarungen erscheint zielführender. Der Gesetzgeber zwingt die Automobilhersteller zu Innovationen im Bremsbereich und damit zur Reduktion von Partikelemissionen aus dem Strassenverkehr. Die Technik bietet Lösungen an und treibt Entwicklung und Forschung im Bremsbereich voran.

Die Wärmeabfuhr von Scheibenbremsen gegenüber Trommelbremsen ist optimaler. Foto: Bugatti
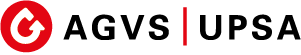

Kommentar hinzufügen
Kommentare